Details
| Autor | Gräber, Angela |
|---|---|
| Verlag | Goethe & Hafis Verlag |
| Auflage/ Erscheinungsjahr | 31.01.2016 |
| Format | 19 cm |
| Einbandart/ Medium/ Ausstattung | Paperback |
| Seiten/ Spieldauer | 118 Seiten |
| Abbildungen | Mit 12 farbige Abb. Die Abbildungen zeigen ausgewählte Zeichnungen von Antonia aus der Kindheit sowie Fotografien von Antonias Grab und Nachttisch. |
| ISBN | 9783940762306 |
Krebs – eine (transgenerationelle) Metapher?
Zu diesem Buch
»Es gibt wohl keinen größeren Schmerz im Leben von Eltern und insbesondere für eine Mutter als den Tod eines Kindes, sei es durch Krankheit, Krieg oder Unfall.
Davon zeugt auch dieses Buch einer viel geschätzten Kollegin, die nach ihrer Anästhesie-Ausbildung Psychoanalytikerin und Ärztin für Psychosomatik und Psychotherapie wurde. Vielleicht war es das Quentchen Glück, das meiner Familie in dieser Hinsicht bisher einigermaßen hold gewesen ist, dass es mir viel schwerer fiel als gedacht, das einmal in Aussicht gestellte Vorwort auch wirklich zu verfassen. Wie schnell einem das Glück aber abhanden kommen kann, weiß man, wenn man Glück gehabt hat, oder wenn man die vielen Verluste zur Kenntnis nehmen muss, die alltagtäglich in Zeitungen, Todesanzeigen und TV-Nachrichten als mediale Ereignisse nüchtern und sachlich mitgeteilt werden. Für die Betroffenen sind sie eher wie ein Anschlag „von außen“ oder eben „von innen“ (Muschg 2012, S.17), der nicht selten mit einer massiven Erschütterung des überlebenden Selbst einhergeht. Nachrichten sind sowieso eher Anschläge, ganz anders als diese Zeilen, mit denen die Kollegin als Mutter in einer Art Liebeserklärung an ihre Tochter um das Verstehen ringt.
Berührend äußerte der israelische Schriftsteller David Grossmann in einem Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 07.12.2013, dass er „auf eine Insel der Trauer verbannt“ sei, seitdem er seinen Sohn Uri in den letzten Stunden des Libanon-Krieges 2006 verloren habe. Die vielen Kondolenzschreiben von Freunden und Schriftstellerkollegen an ihn und seine Frau hätten fast ausnahmslos zum Ausdruck gebracht, dass sie sprachlos seien. Wenn es aber keine Worte mehr gebe, kämen die Klischees, die einen überschütteten und sich anfühlten wie ein Kettenhemd. Dies sei eigentlich unerträglich. Wenn man schon auf eine solche Insel verbannt sei, dann könnte man diesen Ort wenigstens zeichnen, bezeichnen, kartographieren und den Gefühlen einen Namen geben. So gab er seinem letzten Buch, das aktuell am Deutschen Theater in Berlin in einer Bühnenversion aufgeführt wird, den Titel: „Aus der Zeit fallen“. Es sei ein Versuch, das Leben im Bewusstsein des Todes zu verstehen. Auch dieses Buch „Trauer um Toni - Ein früher Tod mit langem Vorlauf “ ist ein solch persönlicher Versuch, das Leben im Bewusstsein des Todes zu verstehen, aber anders, nämlich aus der Perspektive einer Mutter, die sich über ihre Herkunft und ihren transgenerationellen Anteil tiefe Gedanken macht, und ausgerechnet zu einer Erkrankung, die an der „Basis“, auf der man zu stehen gewohnt ist, mit einem Schwellfuß („ödipous“) ihren Anfang nahm.
Das Sterben an einer Krebserkrankung hat nicht nur eine andere zeitliche Dimension als der unvorhergesehene Tod durch einen Unfall oder der vorhersehbare Tod in einem Gefecht. Von der Krebs-Diagnose, die dem Patienten manchmal noch immer verschwiegen oder nur verzögert mitgeteilt wird, bis zum Tod ist es ein unterschiedlich langsames Sterben, der Kampf findet ausschließlich im Innern des eigenen Körpers statt. Dadurch „gewinnen“ der betroffene Mensch und seine nächsten Angehörigen Zeit, über die ihm scheinbar oder offensichtlich zugefügten Ungerechtigkeiten zu sinnieren und sich – manchmal quälend – zu fragen: „warum ich?“, „warum uns?“, „warum mein Kind?“. Oder wie es Wolfgang Herrndorf formulierte, bevor er sich, um die Kontrolle über sein Leben zu behalten, in Berlin wegen seines Hirntumors erschoss: „Den sich minütlich oder sekündlich zu Wort dazwischenmeldenden Gedanken an den Tod versuche ich wegzudrängen, wie ich es mit fünfzehn oder sechzehn schon einmal mit anderen störenden Gedanken getan habe“ (Herrndorf 2013, S.118).
Es gehört zu den besonderen Phänomenen sogenannter „unheilbarer“ Erkrankungen, dass sie auf verschiedensten Ebenen die Frage nach Schuld auslösen. Es geht aber weniger um reale Schuld, sondern um intensive Schuldgefühle, wie wir sie auch bei Überlebenden von Suizidanten kennen. Die Angehörigen fragen sich grübelnd, was habe ich, was haben wir falsch gemacht? Krebspatienten neigen umgekehrt dazu, andere oder gar die Welt für schuldig zu erklären, weil es unerträglich ist, selbst plötzlich betroffen zu sein, derjenige, von dem man sonst als abstraktes Individuum nur unbeteiligt in der Zeitung gelesen oder als nachbarschaftliches Gerücht gehört hat.
Fritz Zorn, ein durch sein Buch „Mars“ weltbekannt gewordener Krebspatient, versuchte seinen Schuldvorwurf etwas abzuschwächen, was diesen aber nicht weniger verletzend machte: „Ich glaube aber, dass dieser Bericht darüber hinausgeht, bloß meinen Eltern die Schuld für das anzukreiden, was ich selber hätte besser wissen und tun müssen. Ich kann meine Eltern heute weniger als die ´Schuldigen´ denn als Mit-Opfer derselben verfehlten Situation ansehen. Sie waren nicht die Erfinder dieser schlechten Lebensweise; sie waren vielmehr – wie ich selbst – die von diesem kritiklos akzeptierten schlechten Leben Betrogenen“ (Zorn 2012, S.46-47). Trotz dieses Versuchs der Relativierung bleibt Fritz Zorn – wie der Mutter von Toni – schließlich eine transgenerationelle Schuld-Perspektive: „Wieweit meine Eltern die Schuld trugen und wieweit sie ihrerseits nur die Opfer einer noch viel größeren Schuld waren, kann ich nur ahnen“ (Zorn 2012, S.48). Er konnte es – im Unterschied zur Mutter von Toni – wirklich nur ahnen, weil die Epigenetik, die Genetik transgenerationeller Einflüsse auf den Nachwuchs, noch nicht „geboren“ war. Inzwischen ist auch in den Naturwissenschaften angekommen, dass sich eine psychische Belastung der Großeltern auf die Enkel über die Genetik als geschwächte Stressregulation neurobiologisch auswirken kann und sogar mit einem erhöhten Suizidrisiko einherzugehen scheint (McGowan und Kato 2008, McGowan et al 2009).
Juliane, die Autorin und Tonis Mutter, drückt diesen Zusammenhang psychogenetisch aus: im Karzinom der Tochter habe sich das „beißende Chaos, das von der Großmutter und Mutter auf sie gekommen war (Affektansteckung), abgekapselt und in den (ödipalen) Schwellfuß entsorgt. Von da an fraß es (!) sich in den ganzen Körper“. Oder wie sie mir persönlich mitteilte: „Das Gift, das ich gezwungen war zu trinken, ging unverdaut durch mich durch, in Antonia hinein“. Die Epigenetik lehrt uns, dass transgenerationelle Deprivationen und Hungerkatastrophen ebenso wie Traumatisierungen einen Einfluss auf die sogenannten Telomere (sogenannte Schalter der Genaktivierung und damit Protein-Produktion) haben, die außerhalb des Genom-Abschnitts durch ihre Kürze oder Länge nicht nur unser Leben, sondern die Art und Weise, wie wir immunologisch leben können, entscheidend mitbestimmen (Meaney 2001, Drury et al 2012). Warum sollten nicht auch seelische Befindlichkeitsstörungen der Großeltern einen solchen Einfluss auf die dritte Generation ausüben?
Einer holistisch eingestellten Psychosomatik, wie sie in Deutschland mit Georg Groddeck im letzten Jahrhundert ihren Anfang nahm und zwischen den Weltkriegen und bis zur Jahrhundertwende zur Blüte kam, waren und sind solche Überlegungen nicht fremd. So wurde in der bedrohlichsten Krise des Einzelnen und der Familie, in diesen Erschütterungen des Selbst, immer ein Sinn gesucht und gefunden, der allerdings versprachlicht werden müsse: „Symptome sind Antworten, die der Organismus auf ganz bestimmte an ihn gestellte Fragen gibt, sie sind zumindest von diesen Fragen mitbestimmt“ (Goldstein 1934, S.11). Neben den Symptomen wurde manchmal der Sinn gleich in den Diagnosen gesucht, wofür sich unerklärlich bedrohliche Krankheiten, wie zum Beispiel Tuberkulose in früheren, AIDS und Karzinomerkrankungen in heutigen Zeiten besonders eignen. Sie induzieren die Suche nach ganz spezifischen, individuellen Metaphern, die „nicht nur Elemente der Sprache“, sondern eines Denkens sind, „das auf die Imagination nicht verzichten kann“ (Buchholz 2008, S.8). Die von solchen Krankheiten ausgelösten Fantasien und Metaphern sind ebenso vielfältig wie mächtig und haben schließlich bis zu der Annahme einer „Krebspersönlichkeit“ oder eines „Typus carcinomatosus“ (Typ C) geführt. Schon in der Antike und im Mittelalter waren Zusammenhänge zwischen einem beeinträchtigten seelischen Befinden und einer „bösartigen“ Tumorerkrankung vermutet worden, wobei der Melancholie und späteren Depression eine Schlüsselstellung eingeräumt wurden (Schwarz 1994). So beschreibt Fritz Zorn seine Depression in der Adoleszenz, Juliane ihre Depression in ihrer ‚Kampfehe‘. Es gehört zu einer der tragischen Aspekte dieser Literatur, dass die Hoffnung, die die Autoren aus der Einsicht in die Ursache ihrer Erkrankung schöpfen, für sie selbst fast immer zu spät kommt.
Im letzten Jahrhundert gab es keine psychosoziale Krebstheorie, die nicht zu irgendeinem Zeitpunkt Oberhand gewann, sei es, dass ein Krebskranker „ein innerlich gehemmter und zwiespältiger Mensch“ sei, „der am Sinn seines Lebens zweifele und […] sich im Bemühen aufgerieben habe, eine versöhnliche Atmosphäre mit der Umwelt zu schaffen“ (Schulz van Treeck 1955) oder dass eine Krebserkrankung konversionstheoretisch als symbolhafter Ausdruck eines Triebkonflikts im Sinne einer Organsprache verstanden wurde (Beck et al 1975). Ein paar Jahrzehnte später galt eine Karzinomerkrankung nicht mehr als symbolische Entsprechung eines Triebkonflikts, sondern vielmehr als Ersatz eines verlorenen Objekts und als Ausgleich eines Mangels auf dem Boden von Kindheitstraumen, einer Grundstimmung, dass alles schief gehen muss bei gleichzeitigen Schuldgefühlen, einem Wiederholungszwang selbstdestruktiven Verhaltens und der Entwicklung eines Doppel-Selbst, „in dem realistische und adaptive Ich-Operationen getrennt von parallel existierenden Gefühlen des Verwundet-Seins, des Nicht-geliebt-Werdens, Isoliert-Seins und der Verlassenheit existieren“ etwa bei Bahnson (1986, S.889) und LeShan (1982).
So befremdlich die verschiedenen theoretischen Erklärungen für den einen oder anderen zunächst wirken mögen, entsprechen sie doch den individuell gewählten Metaphern als wissenschaftlich verpackte, kollektive Form, sich dem Sprachlosen zu nähern.
Metaphern können somit als Versuche angesehen werden, eine erste Antwort, ein erstes Konzept zur Überbrückung des Unerklärlichen zwischen dem Sozialen und Kommunikativen einerseits und dem bildhaft Psychischen andererseits zu finden. Lakoff und Johnson (2008) haben in ihrem „Leben in Metaphern“ verschiedene Gruppen von Metaphern unterschieden, deren Gemeinsamkeit aber die Alltagserfahrung ist. In diesem Sinne spiegeln Metaphern und Wörter überhaupt sensomotorische Konzepte im Sinne von „verkörperlicht“ oder „embodied“ wider, sind also im besten Sinne psycho-somatisch, weil sie auf kindliche, meist prägende, affektiv bedeutsame Erfahrungen zurückgehen (Schrott und Jacobs 2011).
Zahlreich sind die Metaphern, die für Krebserkrankungen öffentlich ins Feld geführt wurden, als Schmarotzertiere, dämonische Schwangerschaft, als Krankheit, die mit Verwelkung einhergehe, Krebs „breitet sich aus“, „wuchert“ oder „dehnt sich aus“, sei eine Erkrankung der Leidenschaft oder das Gegenteil, eine Krankheit unzureichender Leidenschaft, die diejenigen befalle, die sexuell unterdrückt, gehemmt, unspontan und unfähig seien, Wut oder andere Gefühle auszudrücken (Sontag 1981).
Als psychosomatisch richtungsweisend können auch Beobachtungen der Schwächung der Immunabwehr bei Krebskranken – so verschieden diese auch sein mag – gelten, wenn sogenannte „entartete“ Zellen, die offenbar in jedem Menschen vorhanden sind, nicht wie bei Gesunden als schädlich erkannt und vernichtet werden, sondern sich vermehren, ausbreiten und Organe und schließlich den ganzen Menschen vernichten können (Kütemeyer 1981, S.65). Krebszellen sind zunächst die „Anti-Group“ (Nitsun 1996) zu den gesunden Zellen im Körper. Aber ähnlich wie bei traumatischen Erfahrungen in Gruppen kommt es zu „aggregation“ und „massification“-Phänomenen (Hopper 2010), wenn die strukturellen Grenzen – wodurch auch immer – nicht mehr aufrecht erhalten werden können und das Immunsystem seine Fähigkeit verliert, zwischen Körper-Eigenem und Fremden zu unterscheiden, „zwischen Assimilierbarem und Auszustoßendem, zwischen dem Körper zuträglichen und schädlichen Stoffen. Das Immunsystem ist der körperliche Repräsentant der Einzigartigkeit der Person; es ist der Wächter über die körperliche Identität und Integrität des Individuums“ (Kütemeyer 1981, S.65).
Wenn man davon ausgeht, dass die Gruppe vor der Dyade kommt - gemeint ist das familiäre Netz, wenn Eltern ein Kind zeugen, weshalb Otto Kernberg in einem Vortrag einmal die Behauptung aufstellte, wenn zwei Menschen miteinander sexuell verkehren, schlafen eigentlich sechs Personen miteinander (die jeweiligen Eltern des Paares) - dann ist eine transgenerationell-epigenetische Perspektive ebenso verlockend wie methodisch schwierig zu belegen.
Auch „naturwissenschaftliche“ Vorstellungen von Krebserkrankungen sind Metaphern-durchtränkt. Sie unterscheiden sich damit nicht von den in der Öffentlichkeit und in den Medien immer wieder publizierten Vorstellungen, dass „Krebs“ – so mannigfaltig er auch daher kommen mag – als ein Bild für etwas anderes und damit als Metapher verstanden werden muss. Im Falle einer Krebserkrankung soll dieses Schicksal die Unfähigkeit des Kranken widerspiegeln, Gefühle auszudrücken und auszuleben; in letzter Konsequenz sollte diese „Unfähigkeit“ sogar die wesentliche Ursache für diese Erkrankung sein. In dieser Sicht wäre Krebs letztlich selbst verschuldet. Keine Autorin dürfte den Begriff „Krebserkrankung“ lange vor ihrem Tod durch ihre eigene Krebserkrankung schärfer in den Blick genommen und kritisiert haben als Susan Sontag (1981), die – vielleicht auch für sich selbst – argumentierte, dass man Krebs keinesfalls als Metapher verstehen solle.
Aber so einfach ist die Angelegenheit nicht. Metaphern tragen nicht nur dazu bei, dass Theorien oder neue Ideen an Anschaulichkeit gewinnen, sondern haben auch bei Entdeckungen die besondere Funktion, Bekanntes und Vertrautes mit noch Unbekanntem und Fremden zu verbinden (Kächele; Grundmann; Thomä 2013, S.115). Trotzdem wurde in der Forschung der Kontext von Metaphern ebenso wie ihre Kontextualisierung bislang ziemlich vernachlässigt, durch die die Bedeutung von Metaphern nur individuell und situationsspezifisch erschlossen werden können.
Sie alle sind nicht nur Reaktionen auf ein industriell-technizistisches Gesundheitssystem, welches die Hoffnung nährt, dass der medizinische Fortschritt schon alle Krankheiten für heilbar erkennen wird. Gestützt werden solche Hoffnungen durch die – gar nicht so seltenen – „Spontanremissionen“, welche ohne Therapie oder durch Maßnahmen, die einen solchen Verlauf nicht erklären können, immer wieder zu beobachten sind (Kappauf et al 1997, Gallmeier 1998). Eine transgenerationelle Perspektive könnte, wie die Autorin uns in „Trauer um Toni“ nahelegt, auch den Blick auf spontane Remissionen neu lenken.« (aus dem Vorwort)
Die im Buch widergegebenen Abbildungen zeigen ausgewählte Zeichnungen von Antonia aus der Kindheit sowie Fotografien von Antonias Grab und Nachttisch.
Kaufoption
14,90 €
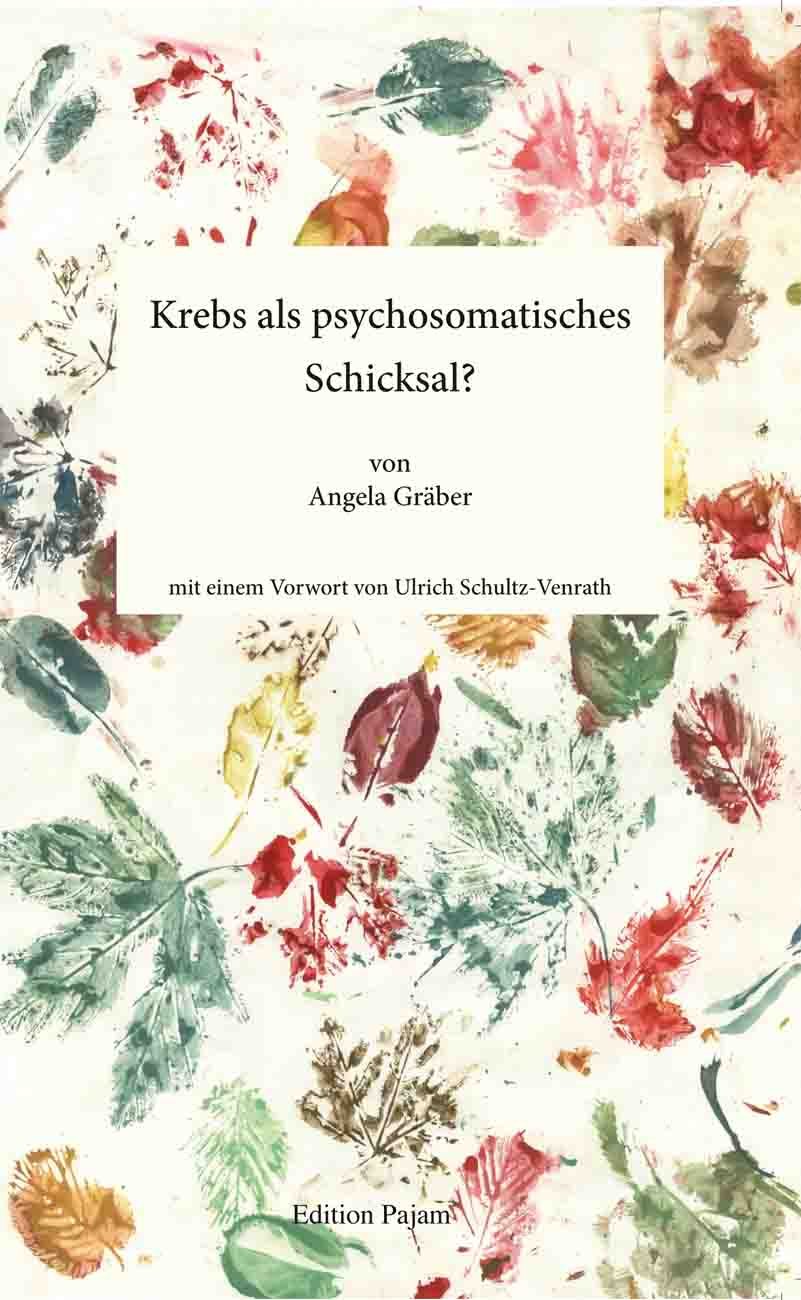
Kommentare
Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Neuer Kommentar
Bitte beachten Sie vor Nutzung unserer Kommentarfunktion auch die Datenschutzerklärung.