Details
| Autor | Ludin, Josef H. |
|---|---|
| Verlag | Vorwerk 8 |
| Auflage/ Erscheinungsjahr | 31.08.2018 |
| Format | 15,4 × 2,7 × 21,8 cm |
| Einbandart/ Medium/ Ausstattung | Paperback |
| Seiten/ Spieldauer | 340 Seiten |
| ISBN | 9783947238071 |
Zu diesem Buch
Die in diesem Band zusammengetragenen Texte des Autors aus den letzten zwanzig Jahren loten aus unterschiedlicher Perspektive die Psychoanalyse im Kern als eine Kulturarbeit aus.
Mit diesem zunächst einmal nicht originärem analytischen Begriff wird der Bezug des Menschen zu seinem Umfeld und Ursprung verstanden, mit denen sich seine Konflikte und Krisen verweben. Dabei greift Ludin im Wesentlichen auf Schriften Freuds zurück und argumentiert einerseits entlang der nachfreudianischen institutionellen Diskurse und Konzepte der Psychoanalyse, aber andererseits auch jenseits davon. Der Autor verwendet einen erzählerischen Stil, den er als der klinischen Erfahrung entsprechend erachtet. Die persönlichen Erfahrungen als Psychoanalytiker zwischen zwei Ländern und sehr unterschiedlichen analytischen Kulturen [Frankreich / Deutschland] sind sein Ausgangs punkt. Ein erster Strang der Texte behandelt das Schicksal des Ödipalkomplexes, die Spuren der Erinnerung und ihrer Entstellungen, die Metapher des psychischen Exils [anhand der Tragödie »König Ödipus«] und der Emigration [anhand Freuds »Mann Moses und die monotheistische Religion«]. Den zweiten Teil bilden Texte über die psychoanalytische Technik, die Mäander der Übertragung, die für den Autor zentralen Themen des Narzissmus und der Sublimierung sowie Bemerkungen zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung und ihrer problematischen Institutionalisierung.
Inhalt
Einleitung
- Doppelzüngigkeit und Mehrzüngigkeit. Sprechen und Identifizieren in der psychoanalytischen Erfahrung
- Überlegungen zur Atopie der analytischen Situation
- Sublimierung und analytische Prozess
- Vergänglichkeit und Sehnsucht
- Zur Aktualität des Narzissmuskonzeptes
- Zum Verhältnis literarischer und analytischer Erfahrung
- Seminar: Das Wesen der Übertragung
- Welche Öffentlichkeit für die Psychoanalyse?
- Geschichte und Realität der Psychoanalyse in Frankreich
- Warum ist die Psychoanalyse eine Kulturarbeit?
- Zum Verhältnis zwischen Institutions- und Ideologiebildung in der Psychoanalyse
- Béla Grunberger und die Frage nach dem Vater
- Seminar: Die Frage der Technik. Wie erreichen wir die psychische Realität unserer Patienten?
- Herkunft, Exil, Krisis als Grundmetaphern der Psychoanalyse
- Vom Opfer zum Verzicht
- Vom Vatermord zum Kindesmord
- Rückkehr als Metapher. Überlegungen eines Psychoanalytikers
- Über die Historische Wahrheit. Vom Wahrheitsverständnis
- Braucht die Psychoanalyse einen Gründungsmythos?
- Seminar: Moses. Zur Rezeptionsgeschichte des »Mann Moses und die monotheistische Religion«
Schlusswort
Aus der Einleitung des Autors
"Es gibt eine Unterscheidung zwischen klinischer und angewandter Psychoanalyse, die auf Freud zurückgeht, die jedoch zu einer Zweiteilung führte, die mir immer problematisch erschien. Die Psychoanalyse ist im Wesen ein klinisches Denken und Tun. Sie hat nicht nur wie philosophisches oder wissenschaftliches Denken mit Texten und Konzepten zu tun, sondern auch mit dem Menschen in seinen Krisen, Verzweiflungen und Verirrungen, dem er eine neue Form von Selbsterkenntnis verordnet. Psychoanalyse unterscheidet sich aber in einem weiteren Sinne auch vom literarischen Sprechen und Schreiben insofern als, dass sie ohne Konzepte nicht auskommt. Die Konzepte sind im Wesentlichen von Freud entwickelt worden, und sie beziehen sich auf die Funktionsweise des Unbewussten, des psychischen Apparates, wie er zu Beginn sagte, und der psychischen Realität. Freuds Denkweise war jedoch den Schwierigkeiten und Bedingungen seiner neuen Wissenschaft, verpflichtet und dies ist nirgendwo besser belegt als in seinem Schreibstil. Dieser Stil ist Ausdruck des klinischen Denkens der Psychoanalyse und sollte daher von uns ernst genommen werden und nicht nur als die spezielle schriftstellerische Begabung Freuds angesehen werden, wofür er zu Recht den Goethepreis der Stadt Frankfurt erhielt. So manches Mal hatte ich mir in den letzten Jahren die Frage gestellt, warum moderne Psychoanalytiker immer weniger Freud zum Modell ihres Schreibens nehmen und ihn immer mehr ersetzen durch universitäre Diskurse. Es ist leicht festzustellen, dass analytische Publikationen versuchen in philologischer Weise die jeweiligen Konzepte zu differenzieren und im Gegensatz zu Freud vorwiegend sich mit Textanalysen zu beschäftigen. Gegen diese Tendenz gibt es diejenigen Analytiker, die sich als Kliniker betrachten und sich auf Fallbeschreibungen und Fallanalysen konzentrieren. Tatsache ist, dass man das eine nicht auf das andere reduzieren kann und Freud selbst beides miteinander verwoben hatte. D.h. er diskutierte seine zumeist von ihm selbst erstellten Konzepte mit den Fragen, die sich ihm persönlich stellten. Fragen, die aus einer Beobachtung, einem Erlebnis, einer Erfahrung stammten, die mit einem Fall im Zusammenhang stehen konnten aber nicht mussten. Er war sich häufig genug sein eigener Fall. Diesen persönlichen Bezug einer Fragestellung betrachte ich als klinisch. So sind viele Texte, wenn sie auch mit klinischen Beispielen arbeiten und argumentieren, in diesem Sinne weniger klinisch als sie vorzugeben scheinen. Der persönliche Bezug der Fragestellung fehlt, er ist in vermeintlicher Wissenschaftlichkeit objektiviert. Donald Winnicott sprach von einem »to be concerned«. Wenn dieses »to be concerned« sich nicht darstellt, dann vermittelte sich mir ein Gefühl des Vermissens, und zwar des spezifisch Analytischen. Es war also schon früh die Frage in mir aufgekommen, in welcher Weise ein Analytiker zu schreiben habe? Bei Freud ist das Modell dafür in jedem Fall gegeben, aber auch Autoren in seiner unmittelbaren Folge wie z.B. Sándor Ferenczi oder auch Winnicott schrieben selbstverständlich in dieser analytischen Weise. Sie schrieben immer auch von ihrem eigenen, ganz persönlichen Denk- und Erfahrungsweg. Sie stellten sich vor ihre Rede und verbargen sich nicht dahinter.
Bei diesem spezifisch Freudschen Stil, den wir als analytisches, sprich auch klinisches Denken zum Modell nehmen wollen, scheint es eine Nähe der geschriebenen Sprache zur gesprochenen zu geben. Zunächst mal ist diese Unterscheidung nicht in jeder Sprache die gleiche. So ist der Unterschied im Französischen deutlicher und radikaler als im Deutschen oder gar im Englischen. Freud benutzte eine der gesprochenen Sprache nahe Schreibweise. Bei den erwähnten Autoren wie Ferenczi oder Winnicott wie bei vielen anderen älteren Analytikern lässt sich dies ebenfalls beobachten. Es wurde in einem Stil geschrieben, der definitiv als analytisch zu betrachten war und der heute Gefahr liefe, als unwissenschaftlich klassifiziert zu werden. Man könnte leicht dazu geneigt sein, dies als Fortschritt anzusehen. Damals habe man in dieser sehr subjektivistischen Weise geschrieben, heute stünde die Psychoanalyse auf solideren Sockeln, und dementsprechend bedürfe es auch eines wissenschaftlich legitimen Gerüstes. Ob dies nicht Scheinargumente einer zunehmenden Normativität sind, wage ich zumindest in Erwägung zu ziehen.
Selbst in Frankreich, wo die essayistische Tradition viel stärker verankert ist, greift diese Normativität der Veröffentlichungen zunehmend durch. Doch ist es in Frankreich weniger die Normativität wissenschaftlicher Veröffentlichungen, sondern eher die Tradition des Schreibens, diese so sehr verehrte Feder, la plume, mit der man schreibt, was einen hoch idealisierten Stellenwert besitzt. Das Vorbild dafür ist der Homme de lettre, der sich schreibend seinen Platz in der Gesellschaft erobert. Kann es sein, dass die verspätete und holprig verlaufende Rezeption Freuds in den frühen Jahren der Analyse darauf zurückzuführen ist, dass dieser Stil des Denkens und Schreibens den Franzosen fremd erschien? War es nicht so gewesen, dass selbst Shakespeare lange auf seine französische Rezeption warten musste, weil dieser so ganz andere Stil als der, den man im französischen Theater gewohnt war, den Franzosen geradezu geschmacklos vorkam?
Die Normativität, die sich in allen Bereichen des Lebens durchzusetzen scheint, erwartet man von der Wissenschaft vielleicht zu Recht als selbstverständlich. Mag sein, dass daran kein Weg vorbeiführt. Speziell für die Psychoanalyse ist sie jedoch eine Sackgasse, und dies scheint an ihrer Sprechweise zu liegen, daran, dass sie im Sprechen geschieht.
Wenn ich versuche das klinische Denken, für das ich die Psychoanalyse halte, an ihrem Sprachstil festzumachen, dann steht sicherlich hierfür die gesprochene Sprache Pate. Die Analyse, so meinte Freud, sei ein Austausch von Worten, und man müsste hinzufügen: von gesprochenen Worten. Wobei die Assoziativität, die von diesem Sprechen gefordert wird, eine ist, die mit dem freien Einfall besser beschrieben wäre, gingen wir vom normalen Ablauf einer beliebigen Sitzung aus. Der Einfall ist das Ereignis, das den normalen Ablauf eines Gedankenganges unterbricht. Er ist der Gedanke, der einfällt, und zwar in der doppelten Konnotation, die uns das Deutsche hier zur Verfügung stellt: »Es fällt mir ein…« verweist auf eine Erinnerung, während »Mir kommt der Einfall…« auf etwas Ungebetenes verweist, auf einen Gedanken, eine Phantasie, die hereinfällt und vielleicht verstörend wirkt, vielleicht erheitert, vielleicht dem bisher Gesagtem einen Sinn verleiht, es deutet. Dieser Einfall, der offenbar eine Freiheit besitzt, ist nun das Material, mit dem der Analytiker denkt, und zwar nicht nur als Einfall seines Patienten, sondern auch seines eigenen. In der philosophischen und dann auch in der wissenschaftlichen Tradition wurde diesen Einfällen, vielleicht auch Inspirationen genannt, immer weniger Raum gegeben. Sie störten die Ernsthaftigkeit seriöser gedanklicher Entwicklungen. Die Psychoanalyse, die von der universitären Wissenschaft nicht mehr ernst genommen zu werden brauchte, verlieh gerade diesen freien Einfällen einen konstituierenden Status. Besteht nicht darin ihre wissenschaftliche Revolution? Einfälle wurden von ihr als unbewusste Gedanken verstanden, und so veränderten sie auch das Verhältnis, das die Psychoanalyse zum Denken insgesamt einnahm. Das Denken, die im eigentlichsten Sinne hohe Position des Philosophen, wurde damit zu einem unbewussten Akt erklärt. Das könnte man getrost als eine Revolution begreifen. Dass in der Philosophie, wenn auch aus ganz anderen Quellen, das Thema auch zum Problem wurde, lässt sich aus Heideggers Differenzierung zwischen Denken und Reflektieren ersehen. Er stellte das Denken in einen poetischen Zusammenhang und differenzierte es von der wissenschaftlichen Reflexion. Wir könnten annehmen, dass er hier einer analytischen Differenzierung zwischen primär- und sekundärprozesshaften durchaus entgegenkam. Denken tun auch Kinder, zum Reflektieren müssen sie erzogen werden.
Die hier veröffentlichten Seminarmanuskripte wurden in unterschiedlicher Variation in verschiedenen Städten abgehalten. So habe ich das Moses-Seminar zuerst in Bordeaux, dann in Lausanne, dann in Zürich und Berlin gehalten. Das Seminar über die Technik in Bern, Berlin, Istanbul und Paris und dasjenige über die Übertragung in Paris, Lyon (mit dem Fokus auf die Entstellung), Bern und Berlin. In diesen Ortsverschiebungen wurde das eine und das andere mitverschoben, auch von der einen in die andere Sprache hineinverschoben. In all meinen Seminaren habe ich immer versucht auf das Interesse der Korrespondenz Freuds aufmerksam zu machen. Freud war nicht nur ein großer Briefeschreiber, sondern, wie bekannt, gründeten die ersten Entwicklungen des analytischen Denkens in der Korrespondenz mit Wilhelm Fliess, später mit C.G. Jung, Ferenczi und vielen anderen. Nun wurde das Briefeschreiben lange schon als eine besondere literarische Form angesehen. Im Briefeschreiben spricht der Schreibende zum Lesenden in ähnlicher Weise, wie wir es aus der analytischen Erfahrung kennen. Dabei wird ein hohes Niveau von Privatheit kultiviert, die ad personam adressiert ist. In Edgar Allan Poes Novelle vom »Entwendeten Brief«, die nicht nur Jacques Lacan, sondern zuvor schon Marie Bonaparte zur Deutung anregte, ist dieses Thema präsent: Es ist ein ungehöriger Akt, einen Brief zu entwenden oder dass dieser seinen Adressaten verfehlt. Dieser ungehörige Akt steht am Anfang der analytischen Erfahrung. Im Sprechen des Patienten verbirgt sich eine heimliche Angst, dass ihm aus dem Fluss seiner Gedanken Dinge entwendet werden könnten, die er so nicht gesagt haben wollte. Dies lässt an die schizophrene Patientin Viktor Tausks denken, die Freud zitiert und die in paranoider Weise von ihrem Geliebten spricht: »[…] er ist ein Heuchler, ein Augenverdreher, er hat ihr die Augen verdreht, jetzt hat sie verdrehte Augen, es sind nicht mehr ihre Augen, sie sieht die Welt jetzt mit anderen Augen.«
Weder Analytiker noch Analysand können sich immer sicher sein, ob das an den Anderen adressierte Wort auch wirklich dort ankommt, wohin es versandt wurde. Die dadurch ausgelösten Peripetien kommen zur Wirkung auf dem »Tummelplatz der Übertragung«, von dem Freud sprach, »auf dem ihm [dem Patienten] gestattet wird, sich in fast völliger Freiheit zu entfalten.« »Völlige Freiheit« mag emphatisch klingen und kann es so nicht geben, doch erscheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass Erfahrung und Denken in der Psychoanalyse der Freiheit des Menschen einen neuen Horizont eröffneten – und mögen wir zuweilen auch »Augenverdreher« sein."
Der Autor
Josef H. Ludin, Facharztausbildung zum Neurologen/ Psychiater in Berlin; Beginn der analytischen Ausbildung im Karl-Abraham-Institut, Fortsetzung ab 1988 in Paris in der Französischen Psychoanalytischen Vereinigung [IPA]; seit 2005 Lehranalytiker in dieser Gesellschaft; nach Aufenthalt in Paris und in Zürich seit Anfang 2017 wieder in Berlin ansässig; Interessensschwerpunkte: das Verhältnis zwischen Psyche und Kultur, Narzissmustheorien und Behandlungstechnik.
Kaufoption
24,00 €
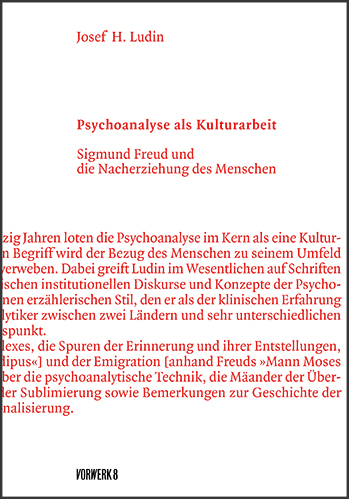


Kommentare
Schreiben Sie den ersten Kommentar!
Neuer Kommentar
Bitte beachten Sie vor Nutzung unserer Kommentarfunktion auch die Datenschutzerklärung.